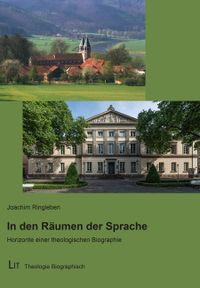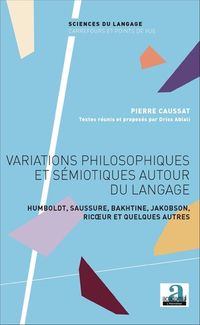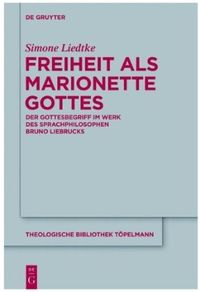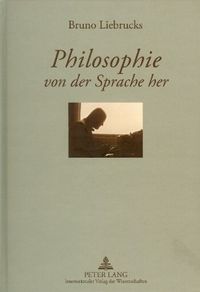Neuerscheinungen
Schmitt, Werner
Sprachformen des Hegelschen Begriffs
Beiträge zu Hegel, Humboldt, Hölderlin aus der Perspektive einer ›Philosophie von der Sprache her‹
Begriff und Konkretion (BK), Band 15
2025. 260 S. ISBN 978-3-428-19404-9
Bruno Liebrucks stellt im Anschluss an W. v. Humboldt und Hegel die Sprache ins Zentrum der Philosophie. Sprache spricht in allem, was der Mensch artikuliert, mit. Hegel trägt diesen nur dialektisch zu begreifenden Vorgang als Entwicklung der Bedeutungsfülle von Begriffen vor. Philosophie kann sich so nicht mehr als Reflexion unter festen Denkformen verstehen. Dabei geht es um die Einsicht, dass der Mensch nur begreift, was in seiner Erfahrung ist, aber das ist dasjenige, was er davon in sprachlichen Formen vor sich aufrichten und damit einer denkenden Betrachtung zuführen kann. Das Hauptthema umfasst die Auseinandersetzung mit dem Denkduktus der formalen Logik, der den technisch-praktischen Weltumgang leitet. Die Darstellungsformen sind neben Zeichen und mathematischen Formeln Wissenschaft und Geldwirtschaft. Der konsequente logische Durchgang durch diese Bewusstseinsstufe ist der Weg in die Gewinnung des sprachlichen Weltumgangs, in dem der technisch-praktische Moment geworden ist.
Sebastian Böhm (Hrsg.) | Thomas Sören Hoffmann (Hrsg.) | Klaus Honrath (Hrsg.)
Thomas Nipperdey. Positivität und Christentum in Hegels Jugendschriften
Begriff und Konkretion (BK), Band 14
2024. 201 S. ISBN 978-3-428-19311-0
Die hier erstmals veröffentlichte Dissertation von Thomas Nipperdey aus dem Jahre 1953 dokumentiert den zunächst philosophischen Arbeitsschwerpunkt des späteren bedeutenden Historikers. In seiner bei Bruno Liebrucks (1911–1986) entstandenen Arbeit zu Hegels Jugendschriften analysiert der junge Nipperdey die verschiedenen Stadien der frühen Hegelschen Kritik der Positivität im Sittlichen wie im Religiösen und rekonstruiert anhand von zentralen Begriffen – Sein, Leben, Versöhnung, Liebe, Sittlichkeit – Hegels frühe Idee(n) hinsichtlich der Konstitution einer nichtpositiven Welt. Dabei wird die Hegelsche Konzeption zugleich mit der Gegenposition Kierkegaards, der sich Nipperdey weitgehend anschließt, kontrastiert. Die Arbeit gewährt sowohl differenzierten Einblick in das philosophische (Spannungs-)Verhältnis zwischen Hegel und Kierkegaard als auch in die Entstehung des Nipperdeyschen Konzepts von Geschichte. Der Ausgabe beigegeben ist ein ausführlicher Kommentar, der Nipperdeys Ansatz systematisch in einen größeren Kontext stellt.
Ringleben, Joachim: In den Räumen der Sprache. Horizonte einer theologischen Biographie, 1. Auflage, 2024, 120 Seiten, 19,90 €. ISBN 978-3-643-15425-5
Um dem Scheinhaften jeder unmittelbaren autobiographischen Darstellung zu entgehen, versucht Joachim Ringleben hier, gleichsam indirekt die prägenden Vermittlungen des eigenen Werdens aufzuzeigen. Intendiert ist eine wirkliche Darstellung dessen in den sprachlichen Räumen von Theologie, Wissenschaft, Philosophie, Kunst und Literatur, bei der Privates weitgehend ausgespart bleibt.
Dabei steht die Sprache in der Mitte seines Denkens und ist der Kristallisationspunkt vielfältiger geistiger Einflüsse. Das eigene Selbst wird im Medium maßgeblicher Anderer bzw. prägender Lektüre-Erfahrungen in seiner Genese reflektiert.
Caussat, Pierre: Variations philosophiques et sémiotiques autour du langage. Humboldt, Saussure, Bakhtine, Ricoeur et quelques autres (= Sciences du langage, vol. 18), Louvain-la-Neuve 2016, 464 p., zu Liebrucks: 384-388.
Max Gottschlich: Der Begriff des konkret Allgemeinen bei Platon und Aristoteles - Eine Infragestellung formallogischer Ontologien?, in: Theologie und Philosophie, Heft 1 (Jg. 89) 2014, S. 1-28 [mit Bezügen zu wesentlichen Punkten von Liebrucks' Platon- und Aristoteles-Interpretation].
Abstract:
Max Gottschlich: Der Begriff des konkret Allgemeinen bei Platon und Aristoteles. Eine Infragestellung formallogischer Ontologien?
Die Frage nach dem konkret Allgemeinen ist gleichbedeutend mit der Frage nach der Einheit des Allgemeinen und Einzelnen. Seit Platon steht diese Frage unter dem Titel des Methexis-Problems im Zentrum der Fundamentalphilosophie. Der Aufsatz verfolgt ein zweifaches Ziel: Erstens sollen dieses Problem und seine Lösungsmöglichkeit in systematischer Weise mit Blick auf Platon und Aristoteles entwickelt werden. Dabei wird der spätplatonischen Dialektik der aristotelische Begriff der Substanz gegenübergestellt, und es wird die Frage betrachtet, ob Aristoteles logisch tatsächlich über seinen Lehrer hinausgegangen ist, oder ob Aristoteles nicht die im Begriff der Substanz enthaltene Dialektik letztlich aus (formal)logischen Gründen zu vermeiden sucht. Dieser Punkt soll zugleich zweitens die gegenwärtig vorherrschende Selbstverständlichkeit, in der von der Autarkie formaler Logik ausgegangen wird, hinterfragen. Denn gerade das Problem einer logischen Fundierung des Substanzbegriffs bei Aristoteles führt zur Frage, ob ein konkret Allgemeines unter der Voraussetzung einer ontologischen Relevanz der formallogischen Axiome überhaupt denkbar sein kann.
The problem of the concrete general notion is equivalent to enquiring about the unity of the general and the singular. Since Plato, this question - which is commonly referred to as the problem of methexis – is one of the most fundamental problems which philosophy is engaged in. This article pursues two goals: Firstly, it aims to provide a brief systematical account on the origin and the solution of this problem with regards to Plato and Aristotle. In doing so, Plato’s solution of the problem of methexis, in the dialectic of his late period, is contrasted with Aristotle’s concept of substance. In this regard the question arises whether Aristotle’s thinking of the problem of methexis has exceeded his teachers achievements in the field of fundamental philosophy or not. Is Aristotle not ultimately avoiding the dialectic, which is contained in the concept of substance – for reasons of formal logic? This point, secondly, shall question the currently prevailing implicitness of the presupposed autarky of formal logic. For it is the very problem of logical justification of the concept of substance in Aristotle which raises this issue: Can the notion of the concrete general be conceivable at all under the precondition that formal logical axioms are also ontologically relevant?
Ungler, Franz: Bruno Liebrucks' >> Sprache und Bewusstsein<<, eingeleitet und herausgegeben von Max Gottschlich, mit einem Geleitwort von Josef Simon, Aufl./Jahr: 1. Aufl. 2014, ca. 608 Seiten, Gebunden, €[D] 49,-
ISBN: 978-3-495-48616-0
Der Wiener Philosoph Franz Ungler ist ein eminenter Vertreter jener von Robert Reininger und Erich Heintel grundgelegten „Wiener Schule“, deren Hauptanliegen die Aneignung und Vergegenwärtigung der systematischen Errungenschaften der philosophischen Tradition ist. Als einer der wenigen Dialektiker des 20. Jahrhunderts erblickt Ungler die gedankliche Herausforderung dabei darin, einerseits nicht hinter die Errungenschaften der Transzendentalphilosophie in naive Ontologien zurückzufallen, andererseits die Probleme der Transzendentalphilosophie einer haltbaren Lösung zuzuführen. Dazu leistete er in seiner außergewöhnlich reichhaltigen und lebendigen Lehre einen bedeutsamen Beitrag. Diese aus dem Nachlass veröffentlichte Vorlesung widmet sich dem anspruchsvollen Werk des Frankfurter Philosophen Bruno Liebrucks (1911-1986), der im Ausgang von denselben systematischen Grundmotiven die Sprache sowie die Logik ins Zentrum seines Denkens stellt. Dabei eröffnet er neue Perspektiven auf die Sprache und auf die Logik, die sich von jenen des Mainstream des 20. Jahrhunderts deutlich abheben. Ungler entwickelt in dieser Vorlesung die Grundlinien von Liebrucks' Kant- und Hegel-Interpretation, wie sie in dessen Opus magnum "Sprache und Bewußtsein" gegeben werden. Als Propädeutik zu dieser anspruchsvollen Darstellung soll eine Einleitung zur Denkergestalt Unglers und zu Liebrucks‘ denkerischer Entwicklung sowie dessen Begriff der Sprache dienen.
Liedtke, Simone: Freiheit als Marionette Gottes. Der Gottesbegriff im Werk des Sprachphilosophen Bruno Liebrucks (Theologische Bibliothek Töpelmann, Bd.160) , 1. Auflage, 2013, 567 Seiten, Gebunden, ca. €[D] 129,95.
ISBN: 978-3-11-031131-0
Mit seiner primär an Hegel orientierten Philosophie der Sprache hat der Frankfurter Philosoph Bruno Liebrucks eine eigenständige Logik und Metaphysik geschaffen, die nicht zuletzt eine Herausforderung für die Theologie darstellt. Den Grund seiner Philosophie sieht Liebrucks in "der Sprache", die er weder als triviales Sprachgeschehen versteht noch im Sinne sprachwissenschaftlicher oder sprachphänomenologischer Betrachtungen, sondern als logische Kategorie, angelehnt an den Hegelschen "Begriff". Dieses ungewöhnliche Verständnis von "Sprache" kann rezipiert werden für eine "Logos"-Theologie, welche die Übersetzung des griechischen Terminus "Logos" sowohl als "Vernunft" wie als "Wort" ernst nimmt und eine neue, gleichermaßen erfahrungsbezogene wie spekulative Auseinandersetzung mit christlicher Tradition und biblischen Schriften eröffnet. Nachvollzug und Darstellung dieser Philosophie des "Logos" führen zu einer Neubetrachtung des Gottesbegriffs, dessen Darstellung und Kritik das thematische Zentrum des vorliegenden Buches bilden. Die Arbeit am Gottesbegriff vollzieht Liebrucks im Kontext der Diskussion des Freiheitsthemas, das vornehmlich über die Auseinandersetzung mit der Freiheit des Menschen angesichts eines existierenden Gottes gewonnen wird. Für den Menschen scheint die eigene Freiheit eine begrenzte und verdankte zu sein. Liebrucks formuliert dies metaphorisch: Der Mensch ist Marionette Gottes. Diese gängige Metapher erhält in der Philosophie der Sprache eine spezifische, paradoxal anmutende Näherbestimmung: Nur als Marionette des (christlichen) Gottes ist der Mensch frei. In der Entfaltung dieser Marionettenmetapher als Logik des Logos liegt die Chance zu einer Begründung ebenso mündigen wie selbstkritischen Denkens und Handelns des Menschen aufgrund eines Bewußtseins für Verantwortlichkeit und Gestaltungskraft innerhalb des umgrenzten Spielraums eigener Freiheit. Die Herausforderung dieser Eigenverantwortlichkeit in bleibender Selbstkritik jedoch kann als eines der dringlichsten Anliegen des Protestantismus verstanden werden.
Freedom as a Marionette of God
Liebrucks uses the New Testament notion of the Logos to propose language as the logical structure for relating to the world. This opens up an engagement with Christian tradition that is at once experiential and speculative. The center of this study is an examination of the concept of God in the context of the question of freedom and its relevance for human self-understanding: what is the meaning of human freedom in the context of a real and existing God?
Gottschlich, Max (Hrsg.): Die drei Revolutionen der Denkart. Systematische Beiträge zum Denken von Bruno Liebrucks, 1. Auflage, 2013, ca. 336 Seiten, Kartoniert, €[D] ca. 39,00.
ISBN: 978-3-495-48618-4
Bruno Liebrucks hat eine eigenständige, an Vico, Herder, Hamann, Humboldt und Cassirer anknüpfende „Philosophie von der Sprache her“ entwickelt, welche Sprache als Medium der Welterschließung begreift. Zu dieser gelangt er durch eine fundamentalphilosophische Auseinandersetzung mit jenen drei Revolutionierungen im Denken des Denkens, die mit den Namen Platon, Kant und Hegel verknüpft sind. Die Beiträge des Bandes gehen diesen „Revolutionen der Denkart“ nach und entfalten grundlegende Perspektiven, die sich von Liebrucks her für das Verständnis der Logik, der Philosophischen Anthropologie, der Ethik und Politischen Philosophie, der Kunstphilosophie sowie der Philosophischen Theologie ergeben. Die Beiträger - u.a. ehemalige Schüler und Assistenten von Liebrucks - sind: Leo Dorner, Max Gottschlich, Thomas S. Hoffmann, Klaus Honrath, Simone Liedtke, Theodoros Penolidis, Brigitte Scheer, Werner Schmitt, Josef Simon, Maria Woschnak, Werner Woschnak, Fritz Zimbrich.
Rezension:
Lelia Edith Profili: Rezension zu "Gottschlich, M. (ed.): Die drei Revolutionen der Denkart. Systematische Beiträge zum Denken von Bruno Liebrucks [Las tres revoluciones del modo de pensar. contribuciones sistemáticas al pensar de Bruno Liebrucks]", in: Logos. Anales Del Seminario De Metafísica 47 (2014), 353-355.
Bruno Liebrucks: Philosophie von der Sprache her. Ein Lesebuch zur Einführung in Sprache und Bewußtsein, hrsg. von Ulrike und Fritz Zimbrich, Peter Lang Verlag, Frankfurt a. M. / Berlin / u.a. 2011.
ISBN: 978-3-631-60700-8
Bruno Liebrucks hat sein Hauptwerk Sprache und Bewußtsein zur Begründung einer "Philosophie von der Sprache her" geschrieben. Entworfen wird eine Philosophie des nicht automatisierten Denkens, das der Sprachlichkeit des Menschen gerecht wird. Das Wesen der Sprache ist das Wesen des Menschen, sagt Liebrucks und stellt sich damit gegen eine Verabsolutierung von Technik und Automation, die bei den Dingen einsetzt und beim Menschen endet. Die Dominanz einer formalen, mathematisierten Logik versperrt den Weg zur Sprache als der Bedingung der Möglichkeit eines geistigen Daseins des Menschen. Das Lesebuch enthält eine Sammlung von längst vergriffenen Liebrucks-Texten, die eine Einführung in das epochale Werk bieten.
Aus dem Inhalt: Aphorismen • Über das Wesen der Sprache • Wirklichkeit und Wirklichkeitsverständnis der Sprache • Ist Sprache Handlung? • Sprache und Denken • Das Logische • Wahrheit • Die absolute Idee der Entsprechung • Das nicht automatisierte Denken • Aufzeichnungen aus dem Nachlaß